Qualifizierungsprogramm Bildungslandschaftsmanager:in BNE
Dialog- und Kompetenzpartner:innen im Programm
Jedes Modul wird von Dialog- und Kompetenzpartner:innen
für den jeweiligen Themenkomplex begleitet.

Hartmut Allgaier
Bildungsbüro der Stadt Freiburg
Hartmut Allgaier leitet seit 2012 das Bildungsbüro der Stadt Freiburg und in der Folge seit 2014 das kommunale Bildungsmanagement. Er war Lehrer für Grund- und Hauptschulen und zehn Jahre Fachberater für Schulentwicklung.
Als eine der ersten Kommunen Deutschlands lässt die Stadt Freiburg seit 2008 ihre Bildungssituation systematisch erfassen. Mit dem 5. Freiburger Bildungsbericht ist 2022 der erste Bericht veröffentlicht worden, der sich explizit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) widmet.
Als Leiter der Stabsstelle Freiburger Bildungsmanagement, hat Hartmut Allgaier den Prozess koordiniert und stellt in der Podiumsdiskussion mit Gästen aus der deutschen Bildungslandschaft dar, wie in seiner Kommune die Wirkungsorientierung in der Erstellung des BNE-Bildungsberichts mitbedacht wurde.

Ilona Böttger
Fields Institute
Erziehungswissenschaftlerin, Geschäftsführerin und Gesellschafterin der Fields GmbH Berlin, Lehrbeauftragte der Alice Salomon Hochschule für Sozialarbeit Berlin, der Hochschule für Nachhaltigkeit Eberswalde und der Freien Universität Berlin, Gesellschafterin und Geschäftsführerin des Fields Institutes.

Prof. Dr. Inka Bormann
Freie Universität Berlin
Frau Dr. Bormann ist seit 2014 Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie studierte Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie in Münster und Berlin und promovierte in Lüneburg. Nach ihrer Habilitation an der Freien Universität Berlin war sie mehrere Jahre als Professorin für Allgemeine Erziehungswissenschaft in Marburg tätig.
Neben der Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt sie sich bereits seit vielen Jahren mit dem Thema „Vertrauen in und gegenüber Bildungsinstitutionen“. In ihrem Arbeitsbereich untersucht sie Fragen des Vertrauens in und gegenüber formalen Bildungsinstitutionen. Dazu zählen Studien zum Vertrauen von Eltern gegenüber Lehrkräften und der Schule ihres Kindes sowie Untersuchungen zur Bedeutung des Vertrauens in der Studieneingangsphase. Die Studien des Arbeitsbereichs schließen an Diskurse im Bereich der Organisationsentwicklung in Schulen und Hochschulen, der Transitionsforschung, der Forschung zu Erziehungs- und Bildungspartnerschaften und Elternbeteiligung, der Habitusforschung sowie der Educational Governance-Forschung an und tragen außerdem zur Weiterentwicklung der Methodologie in der Vertrauensforschung bei.

Prof. Dr. Gerhard de Haan
Institute Futur | Freie Universität Berlin
Seit über 30 Jahren ist Prof. Dr. de Haan in der Bildungsforschung aktiv, speziell in Forschungs- und Entwicklungsprojekten. Er war u. a. Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung sowie Vorsitzender des Nationalkomitees der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005–2014).
Aktuell verantwortet er das Monitoring der Entwicklung von BNE in Deutschland (BMBF Förderung) und ist er Wissenschaftlicher Berater der Nationalen Plattform des UNESCO BNE-Programms „ESD for 2030“.
Er leitete die Studie „Zukunft der schulischen Bildung 2050“ der Stiftung Mercator und erarbeitet den Bildungsbericht zu BNE der Stadt Freiburg (beides im Fields Institute).
Prof. de Haan ist Mitglied auf Lebenszeit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaft und Vorsitzender des "food2innovation Forums".

Dr. Tobias Diemer
Volkshochschulverband Baden-Württemberg
Dr. Tobias Diemer ist Direktor beim Volkshochschulverband Baden-Württemberg und arbeitete in den vergangenen zehn Jahren bei der Stiftung Mercator, seit 2014 als Leiter des Bereichs Bildung. Dort verantwortet er ein Portfolio mit Projekten zur Kulturellen Bildung sowie zentralen Themen einer zukunftsfähigen Bildung im 21. Jahrhundert, u.a. zu kreativer Lernkultur, Zukunftskompetenzen, Digitalisierung und Abbau von Bildungsungleichheit.
Weitere Arbeitsschwerpunkte der vergangenen Jahre waren der Aufbau und die Pflege von Kooperationen mit allen 16 Bundesländern und die Förderung von Länderprogrammen zur Stärkung kultureller Bildung für eine kreativere Unterrichts- und Schulkultur. Vor 2011 war er mehrere Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Freien Universität Berlin in Modell- und Forschungsprojekten in den Arbeitsbereichen Bildungsmanagement und Weiterbildung sowie Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung tätig. In diesem Rahmen untersuchte er die Einführung und Umsetzung neuer Steuerungsinstrumente seit PISA 2000 zur Qualitätssicherung und Unterrichts- und Schulentwicklung.

Dr. Oliver Döhrmann
Ruhrfutur
Dr. Oliver Döhrmann ist seit Februar 2018 Geschäftsführer der RuhrFutur gGmbH. Zuvor hat er sechs Jahre in der Stiftung Mercator im Bereich Wissenschaft hauptsächlich Projekte im Ruhrgebiet betreut und stiftungsweit den Regionalschwerpunkt Ruhr koordiniert.
Oliver Döhrmann hat Philosophie und Psychologie in Düsseldorf studiert, in Psychologie/Kognitive Neurowissenschaften an den Universitäten Frankfurt und Maastricht promoviert und im Anschluss zweieinhalb Jahre am Massachusetts Institute of Technology (MIT) sowie an der Boston University in den USA gearbeitet.

Dr. Anika Duveneck
Fachbereich Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Freien Universität Berlin
Dr. Anika Duveneck ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Allgemeine Erziehungswissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie forscht und publiziert zu „kommunalen Bildungslandschaften“, "Bildung für nachhaltige Entwicklung" sowie zu multiperspektivischer Zusammenarbeit und Transfer im Bildungsbereich.
Sie war von 2015 bis 2020 am Institut Futur der Freien Universität in mehreren Forschungsprojekten, u.a. einer Delphi-Studie zu Bildungslandschaften 2030, dem BMBF-Wettbewerb Zukunftsstadt 2030+ und für das nationale Monitoring des Weltaktionsprogramms Bildung für nachhaltige Entwicklung (Bereich Kommune) tätig. Seit 2020 ist sie u.a. Projektleiterin des BMBF-Metavorhabens zum Abbau von Bildungsbarrieren.

Martina Eick
Umweltbundesamt
Martina Eick ist seit 2002 im Umweltbundesamt, Abteilung Grundsatzfragen, Nachhaltigkeitsstrategien und -szenarien/Ressourcenschonung, tätig. Sie absolvierte ein Studium der Politikwissenschaft und des Umweltschutzmanagements.
Ihre Interessen gelten der Partizipationsforschung und Demokratieentwicklung, Offline-Prozessen und Kollaboration auf kommunaler, lokaler und regionaler Ebene, Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie dem interkulturellen/interreligiösen Dialog. Zudem beschäftigt sie sich mit Themen der Digitalisierung vor Ort, grünem Journalismus, soziokulturellen Digitalisierungsauswirkungen, KI-Ethik und dem EU-Förderkompass für nachhaltige Regionalentwicklung. Immer bewegt sie die Frage, wieviel Institutionalisierung gut und erforderlich ist, um die gesellschaftliche Transformation voranzutreiben und wann diese in Deaktivierung und Passivität umschlägt und
zivilgesellschaftliches Engagement ausbremst.
martina.eick@uba.de

Max von Eller-Eberstein
Max von Eller-Eberstein ist Bachelor of Arts Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Neben seinem Studium war er am Centre for Entrepreneurship der Technischen Universität Berlin für die Organisation der Start-Up School des Centres sowie für der Ausrichtung der jährlich stattfindenden Ringvorlesung verantwortlich.
Danach war er als studentische Hilfskraft (Prof.in Felicitas Thiel, FU Berlin) sowie als wissenschaftliche Hilfskraft und persönliche Sekretär im Arbeitsbereich Bildungsforschung und Soziale Systeme bei Prof. Nina Kolleck beschäftigt.
Seit September 2021 leitet Max für das Fields Institute das Team der Mitarbeitenden, konzipiert und begleitet Workshops und Netzwerkformate und ist in die Konzeption, Organisation, Durchführung und Auswertung fast aller Projekte eingebunden.

Sophia Ermert
Sophia Ermert studierte an der Universität Potsdam Philosophie und an der Humboldt-Universität Gender Studies. Seit März 2020 ist sie in der WerkStadt für Beteiligung tätig.
Seit vielen Jahren befasst sie sich mit den Bedingungen politischen Handelns und der Frage, wie sich Diskussionsräume für möglichst viele zugänglich gestalten lassen. „Ich arbeite in der WerkStadt für Beteiligung, weil wir Beteiligung und Antidiskriminierungsarbeit zusammenführen und die Bedingungen politischer Teilhabe in den Blick nehmen und verändern wollen.“
Die WerkStadt für Beteiligung arbeitet mit dem Ziel, allen Einwohnerinnen und Einwohnern Potsdams einen leichten Zugang zu verschiedenen Formen der aktiven Beteiligung zu ermöglichen. Das Büro versteht sich als Potsdams kommunale Kompetenzstelle für Demokratie, Partizipation und Beteiligung, das all jene berät und unterstützt, die selber Bürgerbeteiligung durchführen oder anstoßen möchten. Die WerkStadt für Beteiligung verfügt über eine zweiteilige Struktur, die unterschiedliche Schwerpunkte bearbeiten. Ein Büro ist Teil der Verwaltung und maßgeblich für Top-Down Beteiligungsprozesse zuständig. Das zweite Büro wird von dem zivilgesellschaftlichen Träger mitmachen e.V. betrieben.

Luzie Heidemann
Bündnis For Future
Die „Fridays for Future“- Bewegung ist wohl eine der bekanntesten Klimabewegungen Deutschlands. Was manchen weniger bewusst sein könnte, ist, dass es eine Vielzahl an weiteren „for Future“- Gruppen gibt. Luzie Heidemann bringt die Organisationen in den Austausch miteinander und ermutigt zum Mitmachen. Luzie Heidemann ist selbst for Future aktiv und eine Art Bindeglied zwischen den Gruppen.
„Klar, Fridays for Future sind die bekanntesten und die wichtigsten, das steht außer Frage. Aber die for Future Gruppen sind unglaublich wichtig, weil da ganz, ganz viel auch im Hintergrund passiert. Also es gibt da ganz viel Expertise, Netzwerk, Engagement und Aktion.“, so Heidemann zum For Future Bündnis. Neben Fridays for Future sind ca. 45 Gruppen in Deutschland auf Bundesebene aktiv. Darüber hinaus gibt es Hunderte von lokalen Gruppen. Über 330 von ihnen sind auf der Bündnisseite des for Future Netzwerks zu finden.
Kay-Uwe Kärsten
WerkStadt für Beteiligung, mitMachen e.V.
Kay-Uwe Kärsten hat an der Universität Potsdam und der Freien Universität Berlin Geschichte und Japanologie studiert. Er ist ausgebildeter Moderator und Mediator mit jahrelanger Berufserfahrung in der Demokratie- und Konfliktarbeit sowie in der Beratung und Prozessbegleitung von Gruppen und Organisationen.
„Demokratie ist für mich eine zivilisatorische Errungenschaft, die es zu hegen und pflegen gilt. Sie ist aber keine feststehende Institution, sondern ein Prozess der stetigen Verhandlung und Veränderung. Ich möchte mit meiner Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Demokratie sich im Sinne von Partizipation, Chancengleichheit und Gemeinwohl entwickeln kann."
Die WerkStadt für Beteiligung arbeitet mit dem Ziel, allen Einwohnerinnen und Einwohnern Potsdams einen leichten Zugang zu verschiedenen Formen der aktiven Beteiligung zu ermöglichen. Die WerkStadt versteht sich als Potsdams kommunale Kompetenzstelle für Demokratie, Partizipation und Beteiligung und berät all jene, die selbst Beteiligung durchführen oder anstoßen möchten. Die WerkStadt verfügt über eine zweiteilige Struktur, die unterschiedliche Schwerpunkte bearbeiten. Ein Teil ist in der Verwaltung und für Top-Down Beteiligungsprozesse zuständig. Der zweite Teil wird von dem zivilgesellschaftlichen Träger mitMachen e.V. betrieben und ist für Bottom-Up Prozesse zuständig.

Botho Karger
Musiker, Dozent UdK Berlin
Botho Karger erhielt seine Ausbildung zum Schlagzeuger und Percussionist bei Armin Keller, German Belmar und an der University of Tennessee, Memphis, USA.
Seit Anfang der 80er Jahre unterrichtet er, war viele Jahre Dozent an der Jazzschule Berlin und gründete 1992 das Trommelzentrum Prenzlauer Berg.
Er hat in zahlreichen Jazz- und lateinamerikanischen Formationen gespielt, war als Theatermusiker an verschiedenen Theatern tätig und gründete 2008 die Gruppe Musik mit Herrn Karger.
Seit dem Wintersemester 2013 unterrichtet er als Dozent an der UdK Berlin im Fachbereich Musiktherapie Rhythmik und Percussion, und seit 2017 als Gastdozent am Orff-Institut Peking.
Seit Januar 2023 spielt er in der Combo "Focus Line".

Julia Klausing
involas Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik GmbH, Leitung Transferagentur Kommunales Bildungsmanagement Hessen
Julia Klausing leitet die Transferagentur Hessen. Die beim Institut für berufliche Bildung-, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik angesiedelte Transferagentur Hessen ist Teil der "Transferinitiative Kommunales Bildungsmanagement" des BMBF. Die Transferagentur Hessen ist Partnerin der hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise und unterstützt diese bei der Weiterentwicklung ihrer kommunalen Bildungslandschaft. Das Angebot beinhaltet Beratung, Qualifizierung und Begleitung von Kommunen auf dem Weg zu einer nachhaltigen kommunalen Bildungsstrategie und einem ganzheitlichen, datenbasierten Bildungsmanagement. Die Transferagentur organisiert dabei den interkommunalen Austausch und fördert die Abstimmung und Vernetzung zwischen den Kommunen in Hessen und Teilen Baden-Württembergs.
In einer Podiumsdiskussion mit Gästen aus der deutschen Bildungslandschaft erläutert Frau Klausing wie kommunales Bildungsmanagement und -monitoring zu einer erfolgreichen, dialogorientierten und kooperativen Bildungslandschaft beitragen kann.

Inga Lutosch
Berlin Governance Plattform
Inga Lutosch studierte in Hannover Landschafts- und Freiraumplanung mit Schwerpunkt auf Konflikten in der Raumplanung.
Nach einer Tätigkeit im Planungsbüro ist sie seit 2004 freiberuflich als Moderatorin, Mediatorin und Trainerin aktiv. Dabei bildet die Schnittstelle Umwelt und Kommunikation einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit. In diesem Kontext moderiert sie (Groß-)Gruppen und mediiert bei Konflikten rund um die Themen Energiewende, Naturschutz und Landwirtschaft. Darüber hinaus bietet sie Mediation und Prozessbegleitung bei Teamkonflikten im Profit- und Nonprofitbereich sowie im öffentlichen Dienst und im Privaten an.
Inga Lutosch hat den Mediator:innenpool des Kompetenznetzwerks Naturschutz und Energiewende mit ausgebildet und ist Co-Trainerin im Rahmen der Mediationsausbildung von Armin Torbecke.
Aktuell arbeitet sie für die Berlin Governance Plattform als Prozessbegleiterin für eine Kommune in der Strukturwandelregion Lausitz. Mit einem Gremium aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft sollen dort Empfehlungen für Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung erarbeitet werden.

Prof. Dr. Marcel Hunecke
Professor für Allgemeine Psychologie, Organisations- und Umweltpsychologie am Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften an der FH Dortmund
Prof. Dr. Marcel Hunecke ist seit 2009 Professor für Allgemeine Psychologie, Organisations- und Umweltpsychologie an der Fachhochschule Dortmund, wo er den Masterstudiengang „Soziale Nachhaltigkeit und demografischer Wandel“ leitet.
Zusätzlich ist er Privatdozent an der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität Bochum. Dort ist er Mitglied der Arbeitsgruppe für Umwelt- und Kognitionspsychologie mit den Forschungsschwerpunkten: Strategien zur Förderung nachhaltiger Lebensstile, Mobilitätspsychologie und Methoden transdisziplinärer Forschung.

Jasson Jakovides
Fields Institute
Volkswirt und Politologe, Gründer und Geschäftsführer von Fields Corporate Responability, Lehrbeauftragter der Alice Salomon Hochschule und der Freien Universität Berlin, Sprecher des Fachforums „Non-formales, informelles Lernen/Jugend“ des UN-Weltaktionsprogramms BNE, Gesellschafter des Fields Institutes.

Kosmas Kosmopoulos
Initiative Luna Park e.V.
Kosmas Kosmopoulos, geboren 1972 in Athen, arbeitet als Choreograf, Performer, Videokünstler und Projektmanager, darüber hinaus auch als Tanz- und Theaterpädagoge. Er studierte Theaterwissenschaften an der FU Berlin, gefolgt von einer tänzerischen und choreografischen Ausbildung u.a. an der Etage e.V. und 1995 – 1998 bei P.A.R.T.S. in Brüssel.
Erste eigene Projekte organisierte er dort, in Berlin und in mehreren europäischen Ländern. 2003 gründete er das Künstlerkollektiv Initiative LUNA PARK, mit dem besonderen Anliegen, die Produktion von zeitgenössischer darstellender Kunst und die künstlerische Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, miteinander zu verbinden. In diesem Kontext entwickelt und realisiert Kosmas Kosmopoulos seitdem regelmäßig eine Vielzahl von Produktionen im Tanz- und Performancebereich und von soziokulturellen und Begegnungsprojekten für Kinder und Jugendliche, Laien, studierende bzw. professionelle Tanzschaffende und Fachkräfte der Tanzvermittlung. 2019 institutionalisierte sich die Initiative LUNA PARK unter seiner Leitung als gemeinnütziger Verein mit Sitz an der Gesundbrunnen-Grundschule, einer Brennpunktschule in Berlin-Wedding. Dort arbeitet die Initiative inzwischen an der Einrichtung einer Künstler*innen-Residenz mit dem Ziel, die Schule langfristig als Produktionsort für den zeitgenössischen Tanz zu etablieren, der die vielfältigen Impulse aus der soziokulturellen Bildungsarbeit nutzt und so Synergien schafft, die beiden Bereichen zugute kommen.
Als Anerkennung für ihre Arbeit, die soziokulturelles Engagement, künstlerische Bildung und zeitgenössische Tanzproduktion modellhaft verknüpft, erhielt die Initiative LUNA PARK im Jahr 2022 den Preis in der Kategorie „Konzept und Innovation“ des MIXED UP-Wettbewerbs der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V. (BKJ) und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Dr. Andreas Krafft
Institute of Systemic Management and Public Governance
University of St. Gallen
Dr. Andreas Krafft ist seit mehr als 20 Jahren Dozent an der Universität St. Gallen (HSG) sowie Management-Trainer und –Berater mit Schwerpunkt in der Arbeits-, Organisations- und Gesundheitspsychologie.
Als Associate Researcher am Institut für Systemisches Management und Public Governance (HSG), Co-Präsident von swissfuture (der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung) sowie Vorstand der Swiss Positive Psychology Association leitet er seit rund 10 Jahren das Internationale Netzwerk des Hoffnungsbarometers.
Dr. Krafft lehrt im Master Zukunftsforschung am Institut Futur der Freien Universität Berlin zentrale sozialpsychologische Theorien und Methoden in Bezug auf Hoffnung, Angst und Erwartungen und deren Auswirkungen auf die Antizipation und Konstruktion von Zukünften.

Karola Lakenberg
Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz
Karola Lakenberg ist Gruppenleiterin Biologische Vielfalt bei der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verkehr und Klimaschutz. Sie engagiert sich seit Jahren für die Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung in Berlin und hat unter anderem den Entwicklungsprozess des „Bildungsleitbilds für ein grünes und nachhaltiges Berlin“ initiiert und gefördert. Sie fördert verschiedene Umweltbildungseinrichtungen in Berlin und betreut finanziell und fachlich die Stiftung Naturschutz Berlin. Zusammen mit der Stiftung Naturschutz entwickelte sie berlinweite Projekte
- Langer Tag der stadtNATUR
- Einsatz der Stadtnaturranger
- Nemo – Naturerleben mobil
- Berliner Umweltkalender
- Naturbegleiter

Julian Offermann
soulbottles
Julian Offermann hat in Münster Soziologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaft studiert und ist jetzt seit 6 Jahren bei soulbottles vor allem verantwortlich für die komplette Lieferkette und deren Verbesserung/Optimierung.
Unter anderem war er auch schon Lead Link der Logistik gewesen (was das ist, erklärt er selbst :-))
Die Gründungsgeschichte von soulbottles ist hier nachzulesen.

Stefanie Ollenburg, M.A.
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK)
Stefanie Ollenburg ist Zukunfts- und Designforscherin sowie Prozessbegleiterin und zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Designforschung an der HBK Braunschweig im Projekt ScenAIR2050 (Exzellenzcluster SE2A) tätig.
Nach langjähriger Tätigkeit als Kommunikationsdesignerin, absolvierte sie ihren Master in Zukunftsforschung an der Freien Universität Berlin. Seitdem beschäftigt sie sich mit Transformationsprozessen, Designerly Thinking und Futures Literacy. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin war sie Teil des Konsortiums im EU Erasmus+ Projekt beFORE, das einen E-learning Prototyp zum Thema Futures Literacy entwickelt hat. Sie leitete Kurse zu Design Thinking und lehrt seit 2018 im Master Zukunftsforschung der FU Berlin u.a. ein Seminar zu partizipativen normativen Verfahren.
Ihr umfangreiches Wissen und Methodenrepertoire setzt sie in verschiedenen Projekten mit zukunftsorientierten Themen im Zusammenhang mit Designprozessen ein, um den Umgang mit Zukünften sowie innovatives Denken zu fördern. Ihre Intention ist es, Transformationsprozesse partizipativ so zu gestalten, um lebenszentrierte und zukunftsfähige Lösungsansätze zu entwickeln.
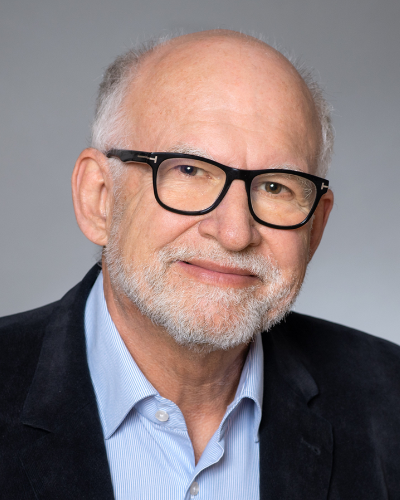
Peter Schaar
Diplom-Volkswirt
Vorsitzender der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz (EAID), Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit a.D. (2003-2013), Vorsitzender der Schlichtungsstelle der gematik- Nationale Agentur für Digitale Medizin.
Peter Schaar war von 1980 bis 1986 in verschiedenen Funktionen in der Verwaltung der Hansestadt Hamburg tätig. 1986 wurde er zunächst Referatsleiter, 1994 dann stellvertretender Hamburgischer Datenschutzbeauftragter. 2002 wechselte er vorübergehend in die Privatwirtschaft und gründete die PrivCom Datenschutz GmbH mit Sitz in Hamburg. Von 2003 bis 2013 war er der Bundesbeauftragte für Datenschutz.
Seit 2007 ist Peter Schaar Lehrbeauftragter an der Universität Hamburg und Leiter der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz e.V. (EAID) in Berlin. Zudem ist er Vorsitzender der Schlichtungsstelle der gematik und Mitherausgeber der European Data Protection Law Review (EDPL).
Peter Schaar ist Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Informationsfreiheit, der Hamburger Datenschutzgesellschaft und der Gesellschaft für Informatik. Außerdem ist er Parteimitglied von Bündnis 90/Die Grünen. Eine dreißigjährige Mitgliedschaft in der Humanistischen Union beendete Schaar am 8. März 2022 aufgrund einer Stellungnahme des Vereins zum Russischen Überfall auf die Ukraine. Für sein Buch „Das Ende der Privatsphäre“ erhielt er 2008 den Preis „Das politische Buch“ der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Schaar ist Preisträger des eco Internet AWARD 2008, Sonderpreis der deutschen Internetwirtschaft des Eco Forum. Die Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherheit (GDD) verlieh ihm 2013 als erstem Preisträger den GDD-Datenschutzpreis. 2014 wurde er von der US-Patientenrechte-Organisation Patient Privacy Rights mit dem Louis D. Brandeis Privacy Award ausgezeichnet.

Dr. Lea Schütze
BNE-Kompetenzzentrum (BiNaKom), Standort Süd
Dr. Lea Schütze ist promovierte Soziologin und Projektleiterin im BNE-Kompetenzzentrum „Bildung – Nachhaltigkeit – Kommune“, angesiedelt am Deutschen Jugendinstitut e.V. in München. Zuvor war sie in der Projektleitung der Transferagentur Bayern Süd für Kommunales Bildungsmanagement zuständig.

Dr. Kerstin Schulenburg
Dialog im Mittelpunkt
Frau Dr. Schulenburg ist seit 1998 als selbstständige Prozessbegleiterin und Dozentin tätig. Berufliche Stationen waren die Filialleitung und Geschäftskundenberatung bei der Commerzbank AG sowie die Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Agrarbetriebs- und Standortökonomie, Fachbereich Internationale Agrarentwicklung an der TU Berlin, wo sie auch promovierte.
Ein Schwerpunkt von Kerstin Schulenburgs ist die Soziokratie als Methode der Organisationsstruktur und der Entscheidungsfindung, in der sich die Mitgestaltung aller und Effizienz verbinden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vernetzung von Akteursgruppen. Kerstin Schulenburg verfügt über umfängliche Erfahrungen in der Initiierung und dem Aufbau von Netzwerken. Zudem hat sie Netzwerke und Netzwerkinitiativen empirisch untersucht und deren Erfolgs- sowie Misserfolgsfaktoren identifiziert.
2020 hat Kerstin Schulenburg das Cohousing-Projekt LiF in Bad Belzig initiiert (www.leben-im-flaeming.de), das seitdem systematisch aufgebaut wird. In diesem werden ca. 90 bis 100 Menschen zusammenleben, eine bunte Mischung in der Altersspanne von 0 und 70 Jahren, die sich in den unterschiedlichsten Lebensphasen und -formen befinden. Die Zusammenarbeit in dem Projekt erfolgt nach den Grundprinzipien der soziokratischen Methode.

Thomas Schwab, MA
Deutsches Jugendinstitut e.V.;
BNE-Kompetenzzentrum „Bildung-Nachhaltigkeit-Kommune“
Thomas Schwab ist seit 2021 Wissenschaftlicher Referent beim Deutschen Jugendinstitut e.V. (DJI) und dort im BNE-Kompetenzzentrum „Bildung-Nachhaltigkeit-Kommune“ tätig.
Davor war er Transfermanager im Bereich Nachhaltige Entwicklung an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, Projekt Mensch in Bewegung (BMBF-Förderinitiative Innovative Hochschule) und von 2011 – 2018 geschäftsführender Referent für Bildung für nachhaltige Entwicklung, BenE München e.V. (Regionales BNE Kompetenzzentrum - RCE)
Im vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Verbundprojekt „Bildung – Nachhaltigkeit – Kommune: BNE-Kompetenzzentrum für Prozessbegleitung und Prozessevaluation (BiNaKom)“, unterstützt er den Aufbau eines BNE-Kompetenzzentrums, das Kommunen entlang der Bildungskette auf kommunaler Ebene strukturell verankern und damit eine notwendige Voraussetzung für eine ganzheitlich nachhaltige Entwicklung in Kommunen schaffen soll.
Eine fruchtbare Zusammenarbeit von Zivilgesellschaft, Verwaltung und Bildungseinrichtungen in lokalen Netzwerken ist Thomas Schwab ein großes Anliegen. Dazu seinen erscheint zeitnah der Artikel „Netzwerke und Kooperation – Wie lässt sich BNE-Zusammenarbeit gestalten?“ im BiNaKom-Praxishandbuch.

Dr. Mandy Singer-Brodowski
Institut Futur
Wissenschaftliche Koordination des Monitorings zum UNESCO BNE-Programms "ESD for 2030“ beim Institut Futur an der Freien Universität Berlin. Sie studierte Erziehungswissenschaft an der Universität Erfurt und gründete während ihres Studiums das studentische Netzwerk Nachhaltigkeitsinitiativen (netzwerk n).
Sie promovierte an der Leuphana Universität Lüneburg mit einer Arbeit über Studierende als Gestalter*innen einer Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung und arbeitete viele Jahre am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie. Bis 2016 war sie wissenschaftliche Koordinatorin des Zentrums für Transformationsforschung und Nachhaltigkeit (TransZent) in Wuppertal.
Seit Oktober 2021 hat sie eine Gastprofessur im Rahmen des europäischen Universitätenverbund UNA Europa der Freien Universität angetreten. Zudem ist sie Vorsitz der BNE-Kommission sowie der Sektion für Interkulturelle und International Vergleichende Erziehungswissenschaft der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft und Mitglied im Forum Hochschule des Programms „ESD for 2030“. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Hochschulbildung für nachhaltige Entwicklung, transformative Wissenschaft und transformatives Lernen.

Sybille Volkholz
Heinrich Böll Stiftung
Schon während ihres Lehramtsstudiums und des Lehramtsreferendariats war Sybille Volkholz politisch aktiv, viele Jahre in der GEW Berlin, deren stellvertretende Landesvorsitzende sie von 1979 bis 1989 war.
Von 1989 bis 1990 war Frau Volkholz für die AL (Alternative Liste für Demokratie und Umweltschutz) Senatorin für Schulwesen, Berufsbildung und Sport im Senat von Berlin.
Von 2000 bis 2004 leitete Frau Volkholz die Bildungskommission der Heinrich-Böll-Stiftung und das Projekt „Partnerschaft Schule – Betrieb“ der Industrie- und Handelskammer Berlin.
Von 2005 bis 2015 organisierte sie mit dem Verein Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI) das „Bürgernetzwerk Bildung“ (jetzt: „Berliner Lesepaten“), das ehrenamtliche Lesepaten an Grund- und Hauptschulen in schwieriger Lage vermittelt.
Von 2012 bis 2021 leitete Frau Volkholz den Fachbeirat Inklusion bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Berlin.
Im Jahr 2012 hat Frau Volkholz gemeinsam mit Anika Duveneck ein Buch zu Kommunalen Bildungslandschaften verfasst. Siehe hierzu auch ein Interview, das die Heinrich Böll Stiftung mit Frau Volkholz und Frau Duveneck führte.
Interview mit Sybille Volkholz und Anika Duveneck (boell.de)

Susanne Waldow-Meier, M.A.
Freie Universität Berlin, Institut Futur,
Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung
Susanne Waldow-Meier hat an der Freien Universität Berlin im Master Zukunftsforschung studiert und interessiert sich besonders dafür, welchen Einfluss Emotionen auf Zukunftsdenken und die Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Krisen nehmen können.
Seit November 2022 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut Futur im Projekt „ESD for 2030: Emotion- and Problem-Focused Coping with Dilemmas, Trade-Offs and Risks in Schools“
In ihrer Masterarbeit mit dem Titel “Zwischen Zukunftsangst und Zukunftsmut. Zur Rolle von Emotionen in der Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Krisen und antizipierter Unsicherheit von Zukunft” kommt Susanne Waldow-Meier zu dem Schluss, dass negativ wahrgenommene Emotionen entscheidende Katalysatoren sein können in der Auseinandersetzung mit Unsicherheiten zu möglichen Zukünften.
Ihre Masterarbeit steht Interessierten als Open-access-document zur Verfügung.